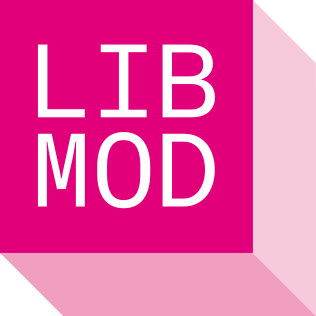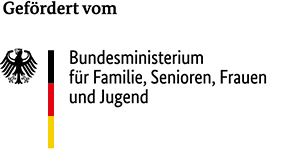Autoritarismus mit libertärem Gestus – kein ganz neues Phänomen

Blinde Flecken der „Kritischen Theorie“: Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey „Gekränkte Freiheit. Aspekte des Libertären Autoritarismus“: Eine Rezension von Marko Martin.
Hatte einst Lenin „eine Partei neuen Typus“ ins Leben gerufen, ist nun in den letzten Jahren eine Rebellenschar (vermeintlich) neuen Typus in der Öffentlichkeit präsent. Querdenker, Covid-Leugner, Putin-Fans, Pharma-Kritiker, Masken-Verweigerer, Eliten-Verächter – you name it. Sie alle übrigens stets beiderlei Geschlechts, obwohl in diesem Milieu wohl ein Binnen‑I oder ein Gendersternchen für helle Aufregung und Empörung sorgen würde.
Es spricht für Carolin Amlingers und Oliver Nachtweys aktuelles Buch „Gekränkte Freiheit“, dass die beiden an der Basler Universität Literaturwissenschaft bzw. Soziologie Lehrenden jene – so der Untertitel – „Aspekte des Libertären Autoritarismus“ dennoch ohne mokante Von-oben-Herab-Attitüde analysieren, wie man sie etwa aus einigen TV-Formaten oder elaborierteren Meinungsforen kennt. Am Anfang nämlich steht eine große Verwunderung angesichts des Phänomens: „Anders als klassische Rechte wollen die Menschen, die nun auf die Straße gehen, keinen starken, sondern einen schwachen, geradezu abwesenden Staat. Sie tragen rechte Verschwörungstheorien vor, aber den Vorwurf, rechts zu sein, weisen sie entschieden von sich. Übergeordnete Instanzen oder vorgegebenes Wissen betrachten sie mit Skepsis. Die libertären Autoritären identifizieren sich nicht mit einer Führerfigur, sondern mit sich, ihrer Autonomie. Anders als klassische Autoritäre, die die vermeintliche moralische Schwäche ihrer Gegner herausstellten, genießen es libertäre Autoritäre, die Bigotterie ihrer Kritiker:innen aufzuspießen.“
So schreibt es das AutorIn-Duo in der Einleitung zu seinem Buch, das alsdann in acht Kapiteln diese These – genauer: die psycho-soziologische Beobachtung – konkret beglaubigt, nicht zuletzt anhand zahlreicher Interviews mit Menschen aus der sogenannten Wutbürger- und Querdenker-Szene. Wohltuend frei von moralisierendem Tremolo wird hier ein Typus beschrieben, wie er in den klassischen Texten der Kritischen Theorie und deren damaligen Untersuchungen über den „autoritären Charakter“ kaum je vorkam. Das ist erhellend und plausibel, markiert aber gleichzeitig ein eminentes Strukturproblem. Wie nämlich kann man/frau darüber verdutzt sein, dass Autoritäres nicht immer zwangsläufig „rechts“ ist? Und so ausführlich hier der aggressive Ich-Kult und der jegliche gesellschaftliche Mäßigung und Solidarität aufkündigende Habitus dieses Milieus analysiert wird – ist das alles tatsächlich „neu“?
Schon die Erinnerung an seinerzeit beliebte Sprüche wie „High sein/ Frei sein/ Terror muss dabei sein“ oder den populären Slogan „Keine Macht für niemand“ hätte genügt, um die diese These nachhaltig zu erschüttern. Auch wenn Carolin Amlinger Jahrgang 1984 ist und Oliver Nachtwey 1975 geboren wurde (der Autor dieser Zeilen kam 1970 zur Welt) – es ist zumutbar, dass man auch von Entwicklungen und Phänomenen Kenntnis besitzt, die vor der eigenen Geburt bzw. der intellektuellen Bewusstwerdung datieren.
Es irritiert, dass Amlinger und Nachtwey konsequent ausblenden, was ihrer „Neuigkeits-Diagnose“ widersprechen würde. Die Untersuchungen von Horkheimer / Adorno zum autoritären Charakter und ihre „Dialektik der Aufklärung“ – eine Bibel der 68er-Bewegung – scheint noch heute der unhinterfragbare Bildungshorizont der Verfasser zu sein. Ließe das womöglich auch Rückschlüsse auf den akademischen Betrieb zu, in dem bis heute wichtige AutorInnen keine Rolle spielen, deren Bücher eben keine Referenztexte geworden sind?
Obwohl die Literaturliste am Ende dieses äußerst lesbar und fluide geschriebenen Buchs nicht weniger als 38 Seiten umfasst, sucht man all die folgenden Namen dort vergebens: Hannah Arendt, Raymond Aron, Daniel Bell, Ralph Dahrendorf, Joachim Fest, André Glucksmann, Václav Havel, Jeanne Hersch, Karl Jaspers, Richard (nicht Leo) Löwenthal, Ludwig (nicht Herbert) Marcuse, Odo Marquard, Alice Rühle-Gerstel – eine linke Frauenrechtlerin und frühe Kritikerin kommunistischen Autoritarismus –, Manès Sperber, Dolf Sternberger. Man vermisst eine ganze Denktradition antitotalitärer Theorie und Kritik. Das festzustellen ist keine wohlfeile Krittelei, sondern betrifft den Kern dieses Buches. Das egomanische Freiheits-Missverständnis, das den vermeintlich neuen „libertären Autoritären“ hier völlig zu Recht bescheinigt wird – es ist ja bereits vor Jahrzehnten von diesen Autor/innen genau und en détail seziert worden. Dies übrigens nicht ohne den begleitenden Hohn vieler damaliger „Adorniten“, die – Stichwort „Es gibt kein wahres Leben im Falschen“ – jegliche Reflexion über die notwendige, stets fragile Balance zwischen individueller Freiheit und institutionell garantierter Mäßigung für einen besonders heuchlerischen Budenzauber des „Establishments“ und des „Systems“ hielten. Kein Zufall, dass das Schlagetot-Wort vom vermeintlich dauer-repressiven „System“ nun in der Querdenker- und Querfront-Szene erneut en vogue ist, inklusive eines zuvor hauptsächlich beim linksliberalen Kabarett- und Stadttheater-Publikum beliebten Spotts über den „FDGO-Staat“, in dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung gestern wie heute verächtlich gemacht wird. Durchaus fatal, dass eine antitotalitär linke bis konservativ-liberale Tradition profunden Nachdenkens über die inhärente Janusköpfigkeit der Freiheit in Deutschland so wenig gesellschaftliche Wurzeln geschlagen hat und im universitären Diskurs allenfalls am Rande wahrgenommen wird.
Man muss Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey entschieden widersprechen, wenn sie zu ihrem derart ausführlich umkreisten Referenz-Objekt schreiben: „Die klassische Kritische Theorie entstand im Angesicht des Totalitarismus.“ Schon der Begriff „Totalitarismus“ war vielen Vertretern der „Frankfurter Schule“ suspekt. Zahlreiche ihrer Anhänger gingen dann über die Jahrzehnte hinweg mit der These hausieren, die Totalitarismus-Theorie – obwohl doch vor allem von jüdischen Emigranten entwickelt – sei nichts als ein hetzerisches Kind des Kalten Krieges und vor allem dazu angetan, „die Verbrechen des Faschismus zu relativieren“.
In einem Brief an Herbert Marcuse verortet Theodor Adorno im Sommer 1969 Hannah Arendt gar bei der „Rechten“. Arendts „Ursprünge des Totalitarismus“ fanden in Deutschland ein empörend spätes Echo. Die Kenntnis des östlichen Totalitarismus ist bis heute allenfalls löchrig vorhanden; die eindrücklichen Erfahrungsberichte der Dissidenten von damals spielen kaum eine Rolle. Wie anders wäre zu erklären, dass Amlinger und Nachtwey in ihrem Buch schreiben: „Als der sozialistische Ostblock ab 1989 zusammenbrach, verengte sich der utopische Raum vollends. Mit den sozialistischen Utopien verlor ein Teil des intellektuellen Protests seine normativen Maßstäbe. Ideale wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit büßten zwar nicht an Geltungskraft ein, sie haben sich aber von ihrer ‚Zukunftsorientierung‘ entkoppelt.“ Man reibt sich die Augen: mit dem Zusammenbruch des sowjetischen Herrschaftssystems ist die sozialistische Utopie verlorengegangen? Bei allem Respekt: Wie entkoppelt von geschichtlichem Basiswissen muss man sein, um so etwas drucken zu lassen?
Auf dieser falschen Prämisse aufbauend, wird dann ein schiefes argumentatives Gerüst gezimmert: Das Freiheitsversprechen der westlichen Postmoderne sei nicht gehalten worden, die gegenwärtige Hyper-Individualisierung ende in Enttäuschung und Stress, sprich in eben jener „Gekränkten Freiheit“. Von gar nicht so fern grüßen die alten Wortblasen von der „Repressiven Toleranz“, dem „Verblendungszusammenhang“, der „Verwalteten Welt“ und des „Eindimensionalen Menschen“. So plausibel im Detail auch die Beschreibung des Missverhältnisses zwischen plakativ hochgehaltenen Persönlichkeitsrechten und real bestehenden, sich mitunter sogar verschärfenden sozialen Zwängen auch ist – was, wenn die Enttäuschung darüber nicht auch ein typisches Privilegierten-„Mimimi“ enttäuschter WestlerInnen wäre? Möglicherweise verzerrt die bis heute andauernde Unkenntnis mörderischer Gewaltstrukturen anderswo den Blick auf hiesige Probleme. Dabei leidet der überwiegende Teil der Menschheit keineswegs unter „Konsumterror“, sondern unter realer Armut und dem realen, politischen Terror, den die unzähligen Klone aus George Orwells „1984“ ausüben. Es heißt nicht die uneingelösten Versprechen der liberalen Demokratie schönzureden, wenn man auf dem fundamentalen Unterschied zwischen einer freien Gesellschaft und autoritärer Herrschaft beharrt. Die Sehnsucht nach der widerspruchsfreien Freiheit und Gleichheit mutet narzisstisch an. Da halte ich es lieber mit einem anderen Hit der sechziger Jahre, in dem es vernehmbar für alle Erwachsenen hieß: „I never promised you a rose garden.“
Was die beiden AutorInnen vorschlagen, um die vom Versprechen der Freiheit „Gekränkten“ zurückzuholen, rekurriert auf den Gedanken gesellschaftlicher Verpflichtung und Verflechtung. Das ist in den meisten Fällen plausibel und wurde von der Reihe obengenannter AutorInnen bereits zu einer Zeit vertreten, als sich „Gekränkte“ noch als „genuin links“ empfanden. Vielleicht wäre es endlich an der Zeit, die Perspektive zu weiten und angesichts der realen, weltweiten Schrecken zu dem zu finden, was André Glucksmann einst angemahnt hatte, ein Wort des tschechischen Husserl-Schülers Jan Patočka aufgreifend, der 1977 sein Engagement für die Gründung der Oppositionsbewegung „Charta 77“ mit dem Leben bezahlte: „Eine Solidarität der Erschütterten“. So manch wehleidig hiesige Klagen würden sich dann wohl von selbst erledigen.
Carolin Amlinger/ Oliver Nachtwey: Gekränkte Freiheit. Aspekte des Libertären Autoritarismus. Suhrkamp Verlag, Berlin 2022, 478 Seiten.